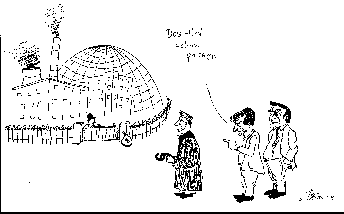akj
Home
Erklärungen
das
freischüßler
Ausgabe
1/99
Ausgabe
2/99
Ausgabe
3/99
Ausgabe
1/00
Ausgabe
2/00
Ausgabe
3/00
Ausgabe
1/01
Ausgabe
2/01
Ausgabe
1/02
Ausgabe
1/03
Ausgabe
2/03
Ausgabe
1/04
Ausgabe
1/05
Vorträge
Projekte
Seminare
Links
Impressum
Atomausstieg
Der ermüdende Stuhltanz um das Abschalten der deutschen Atomkraftwerke (AKW) und den Ausstieg aus der Kernenergie droht schon bald zu einem neuen Kapitel politischer Handlungsbeschränktheit und damit zur großen Wählerenttäuschung zu werden. Während man im Bundesumweltministerium mit allen denkbaren Mitteln nach dem richtigen Notausgang sucht, drohen die BetreiberInnen der AKWs, die Bundesregierung bei einem gesetzlich erzwungenen Ausstieg aus der Kernenergie auf bis zu 50 Milliarden Mark zu verklagen.1 Darüber hinaus kündigte der Chef des Bayernwerks, Otto Majewski, eine Klage vor dem Verfassungsgericht an.2 Selbst Prof. Dr. Rudolf Steinberg, Atomgutachter für rot-grüne und SPD-geführte Landesregierungen, warnte vor einem Rechtsstreit mit der Nuklearwirtschaft. "Nur für Juristen", so der Frankfurter Staatsrechtler, "wären das herrliche Zeiten."3
Wege zum Ausstieg
Grundsätzlich lassen sich zwei Wege unterscheiden, auf denen die Bundesregierung den Ausstieg angehen könnte: den administrativen de lege lata, also mittels ausstiegsorientierter Ausschöpfung der Handlungsspielräume des geltenden Rechts, und den legislativen de lege ferenda. Die Anwendung beider Möglichkeiten legitimiert sich durch das in Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG verankerte Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit sowie die in Art. 20a GG festgeschriebene Pflicht des Staates, in Verantwortung für die künftigen Generationen auch die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen.
Verfassungsmäßig ist der Staat nicht nur verpflichtet, jegliche Verletzung in die Schutzgüter des Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG zu unterlassen, sondern sich auch schützend und fördernd vor sie zu stellen, um sie insbesondere vor Gefährdungen durch Dritte zu bewahren. Daher sollte angesichts der Art und Schwere der Gefahren und Risiken, wie sie von der "friedlichen Nutzung der Kernenergie" ausgehen, bereits die "entfernteste Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts genügen, um die Schutzpflicht auch des Gesetzgebers konkret auszulösen."4 Der oder die einzelne hat keine Möglichkeit, sich der Gefahrenquelle zu entziehen oder sich anderweitig selbst zu schützen, weshalb die Betreibung von AKWs doch eigentlich nur dann mit dem GG zu vereinbaren ist, wenn die Möglichkeit des Schadeneintritts praktisch ausgeschlossen werden kann.
Die Tatsache, dass dennoch 19 AKWs in Deutschland strahlen dürfen, begründet sich aus dem am Maßstab der "praktischen Vernunft" orientierten Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit. Damit ist Raum für Kosten-Nutzen- und Wirtschaftlichkeitsanalysen geschaffen, welche diejenigen Risiken, deren weitere Minimierung unverhältnismäßig wäre, als Restrisiko von jedem einzelnen hingenommen werden müssen.5
Der administrative Weg
Der administrative Ausstieg erscheint angesichts der verfahrenen Atomkonsensgespräche und dem gesetzgeberischen Willen zum schnellen und unwiderruflichen Atomverzicht, der ohne gesetzliche Neuregelung kaum auskommen wird, auf lange Sicht als uneffektiv. Er ist aber zu beschreiten, solange es um die Stillegung einzelner AKWs geht. Hierfür sind die bei Inbetriebnahme des Meilers erteilten Genehmigungen zurückzunehmen oder zu widerrufen, wie es in § 17 Abs. 2 bis 5 AtomG speziell und abschließend geregelt ist. Danach kann eine Genehmigung u.a. zurückgenommen werden, "wenn eine ihrer Voraussetzungen bei der Erteilung nicht vorgelegen hat" 6 (sei es auch nur durch das Vorliegen eines erkennbaren anfänglichen Mangels) oder "wenn dies wegen einer erheblichen Gefährdung der Beschäftigten, Dritter oder der Allgemeinheit erforderlich ist und nicht durch nachträgliche Auflagen in angemessener Zeit Abhilfe geschaffen werden kann."7
Auf dieser Grundlage wäre ein Widerruf gem. §17 Abs. 5 AtomG für das AKW Stade denkbar, an dessen Reaktorbehälter nach einer Untersuchung des "Bundes für Umwelt und Naturschutz" (BUND) gefährliche Versprödungen nachgewiesen werden konnten. Angesichts des fortgeschrittenen Alters dieses Meilers wäre eine Nachrüstung solchen Umfangs kaum rentabel. Auch dem dienstältesten AKW Obrigheim könnte gem. § 17 Abs. 3 Nr. 2 AtomG ein ähnliches Schicksal ereilen, da dessen Notkühlsysteme nicht adäquat auf einen Bruch der Hauptkühlmittelleitung reagieren können.8
Eine weitere Angriffsfläche bietet die Pflicht der BetreiberInnen zur Entsorgung radioaktiver Abfälle. Denn da die Sicherstellung der schadlosen Verwertung oder Beseitigung der anfallenden radioaktiven Reststoffe durch Endlagerung in angemessener Frist offensichtlich nicht garantiert werden kann,9 käme ein Genehmigungswiderruf nach § 17 Abs. 3 Nr. 2 AtomG in Frage. Zudem ist ein gefahrloser Transport der rückständigen Brennelemente nach den Erfahrungen der letzten 12 Jahre keineswegs gewährleistet. Dies ergibt sich weniger aus den zahlreichen Protestaktionen als viel mehr aus der erwiesenermaßen bewußten Inkaufnahme von Conterminationen an Castorbehältern bei deren Verlassen der AKWs.10
Im Falle einer Rücknahme bzw. eines Widerrufs müssen dem oder der berechtigten BetreiberIn gem. § 18 Abs. 1 AtomG angemessene Entschädigungsgelder gezahlt werden, sofern nicht die im Abs. 2 genannten Ausnahmen vorliegen. Danach ist eine Entschädigung ausgeschlossen, wenn die Gefahr nachträglich eingetreten und in der genehmigten Anlage oder Tätigkeit begründet ist. Bei nachträglichen Änderungen des Standes von Wissenschaft und Technik ist zu differenzieren, ob es sich um eine Neuentdeckung oder lediglich um eine Neubewertung längst bekannter Gefahrenquellen handelt.
Lag die Gefahrenursache nämlich bereits anfänglich vor und war dies für die Genehmigungsbehörde erkennbar, kann der oder die BetreiberIn grundsätzlich eine Entschädigung verlangen. War die Gefahrenquelle aber zum Zeitpunkt der Antragsprüfung unter Berücksichtigung sämtlicher Erkenntnismöglichkeiten für die Behörde nicht erkennbar, trägt der oder die AntragstellerIn das volle Risiko, wenn sich die Anlage im nachhinein doch als gefährlich erweist.
Betrachtet man nun die durch die Wissenschaft völlig neueingestuften Gefahren der Niedrigstrahlung und vergleicht man die Gefährdung, die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik im Zeitpunkt der Erteilung der Betriebsgenehmigungen zugrunde gelegt wurde, mit jener, die nach heutigem Erkenntnisstand allein von dem unlösbaren Problem der Endlagerung radioaktiver Rückstände ausgeht, so lässt sich die Frage stellen, ob dies nicht über eine bloße Neubewertung bekannter Risiken hinausgeht und als nachträglich eingetretene, erhebliche Gefährdung einen entschädigungsfreien Widerruf nach § 18 Abs. 2 Nr. 3 AtomG legitimiert.
Zwar billigt das BVerfG "die normative Grundsatzentscheidung für oder gegen die rechtliche Zulässigkeit der friedlichen Nutzung der Kernenergie" allein dem Gesetzgeber zu,11 aber mit der Verabschiedung des AtomG hat er in der Vergangenheit gerade diese Entscheidung eindeutig zugunsten der Atomenergie gefällt. Daher wäre die Umsetzung politischer Zielvorgaben zum administrativen Ausstieg mittels ausstiegsorientierter Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe oder einseitiger Ermessensausübung mit dem Sinn und Zweck des AtomG nicht vereinbar und verstieße daher gegen den in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Ein Totalausstieg aus der Kernenergie ist auf diesem Wege auch deswegen nicht realisierbar, weil ein Verstoß gegen den o.g. Grundsatzentscheid des Gesetzgebers rechtswidrig wäre.
Der legislative Weg
Die Zulässigkeit normativer Änderung mit dem Ziel des Ausstiegs aus der Kernenergie ergibt sich sowohl aus dem oben zitierten Kalkar-Urteil des BVerfG als auch aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 11a GG, welcher die Grundsatzentscheidung zum Gegenstand konkurrierender Gesetzgebung erklärt. Der Kern eines entsprechenden Gesetzes beträfe die nachträgliche Befristung der Betriebserlaubnis von AKWs. Das erhebliche Gefährdungspotential der Technologie, das denkbare Versagen von Schutzmaßnahmen und die ungeklärte Entsorgungsfrage müssen allerdings der verfassungsrechtlichen Prüfung standhalten, ob die ursprüngliche Entscheidung auch unter den veränderten Umständen aufrechterhalten werden kann oder ob das mit dem Ausstieg verfolgte Interesse überwiegt.
Danach richten sich auch die von den KernkraftwerksbetreiberInnen aus dem rechtsstaatlichen Grundsatz des Vertrauensschutzes geltend gemachten Entschädigungsansprüche. Um das einseitige staatliche Handeln in mehrpoligen Rechtsverhältnissen zu unterbinden, hat die Gesetzgebung ein Mindestmaß an Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit einzuhalten. Dies muss insbesondere dann gelten, wenn die Gesetze darauf angelegt sind, Entscheidungen, Dispositionen und letztlich auch Investitionen herbeizuführen. Dabei muss jedoch eine weitgehende Rücksicht auf das öffentliche Interesse gewahrt bleiben. So stellt sich denn erneut die Frage, ob das Vertrauen auf bereits getroffene Dispositionen schutzwürdiger erscheint, als der verfassungsmäßig geforderte Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit.
Der einzig optimale Schutz vor den Risiken der Kernenergie wäre die sofortige Abschaltung aller AKWs. Dennoch kann der Gesetzgeber gezwungen werden, den durch die vorzeitige Beendigung der Kernenergienutzung entstandenen Vertrauensschaden durch angemessene Übergangsregelungen, Härteklauseln oder Vorschriften zum finanziellen Ausgleich abzumildern. Unter diesen Voraussetzungen erschiene der gesetzliche angeordnete Ausstieg aber erst dann angemessen, wenn die Kernkraftwerke sukzessive ihrem Alter und den Sicherheitsstandards entsprechend vom Netz genommen werden würden. Genau darauf spekulieren die BetreiberInnen, wenn sie unter Androhung horrender Entschädigungsforderungen auf die profitable Abschreibung ihrer unbefristet genehmigten Werke über weitere 35 Jahre hinweg gieren.
Dabei ist ernsthaft daran zu zweifeln, dass die BetreiberInnen bei konsequenter Anwendung der Schutzbestimmungen und ohne die bislang großzügig verteilten Subventionen überhaupt ein begründbares Interesse am Fortbestand der Betriebsgenehmigung haben können. "Selbst die unbestreitbar enormen Einnahmen schrumpfen bei einer Totalgewinnberechnung für die jeweilig vorstellbaren Restlaufzeiten hinweg, wenn berücksichtigt wird, dass die Betreiber(Innen) auch die Kosten für die Endlagerung der radioaktiven Rest- bzw. Abfallstoffe im Ergebnis selbst finanzieren müssen."12
Letztlich sind bei einem Rückzug aus der internationalen Plutoniumwirtschaft auch die aus den mit Frankreich und Großbritannien geschlossenen Verträgen zur Wiederaufbereitung abgebrannter Brennelemente erklärten Entschädigungsansprüche von über 3,5 Milliarden DM13 hinfällig. Das ergibt sich aus der vertragsmäßigen Garantie, dass jede Vertragspartei von der Verantwortlichkeit für die Folgen von Vertragsstörungen freigesprochen wird, wenn diese durch Gründe wie z.B. Gesetze oder Beschränkungen durch die Regierung entstanden ist.14 Das ermöglicht ein schadensersatzfreies Verbot der Wiederaufarbeitung.
Schlußbetrachtungen
Wie auch immer dieser Stuhltanz entschieden wird und wer letztendlich wem die Legitimation unter dem Hintern wegzieht, bleibt abzuwarten, auch wenn nach den BVerfGE der Vergangenheit die Drohgebärden der Atomlobby mehr sein dürften als nur heiße Luft. Denn gerade die durch den Ausstieg berührten Grundrechte aus Art. 12 Abs. 1 S. 1 und 14 Abs. 1 S. 1 GG haben die BetreiberInnen in eine Lage versetzt, aus der das erfolgreiche Einklagen von Entschädigungen lohnenswerter erscheinen könnte als der Weiterbetrieb.
Es ist durchaus anzunehmen, dass sie bei optimaler Anwendung des administrativen Weges um einiges von ihren Forderungen abgerückt wären, wenn nämlich die notwendigen Investitionen zur Einhaltung der Schutzbestimmungen, die unter den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen hätten erweitert werden können, den Reinertrag der AKWs überstiegen. Zumal die massiven staatlichen Subventionen für die Kerntechnologie bereits entfallen sind. Die Ankündigung des Umweltministeriums, dass spätestens 2004 an allen Meilern neue Zwischenlager für verbrauchte Brennelemente stehen müssen, ist ein Schritt in die richtige Richtung.15 Außerdem gilt der Vertrauensschutz nur für bereits errichtete und in Betrieb befindliche Anlagen, weswegen ein Verbot des Neubaus von AKWs möglich ist.
Diese Art des ökonomischen Atomausstiegs hätte u.U. nicht länger gedauert, als die versuchte. Dennoch bleiben Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Ausstiegsvorhabens. Aus dem Sozialstaatsprinzip und der Pflicht zur Herstellung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ergibt sich die Garantiestellung des Staates für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Elektrizität. Da der Rückgang der Kohleenergie in den Abdeckgebieten der Kernkraftwerke stark vorangeschritten ist und alternative Energiequellen durch die massive, einseitige Subventionierung der Kernenergie nur unzureichend aufgebaut wurden, bleibt der Import von Atomstrom aus anderen EU-Mitgliedsstaaten zunächst unvermeidlich. Dazu kommt das Vorhaben der Bundesregierung, die CO2-Belastung zu halbieren, an deren Entstehung die Kohleenergie keinen unwesentlichen Anteil hat. In wie weit kann also überhaupt von einem wirklichen Verzicht kerntechnisch erzeugten Stroms ausgegangen werden?
Die Bemühungen um den Atomausstieg in Deutschland verfolgen bei aller Kritik an der Art und Weise ihrer Abwicklung dennoch das richtiges Ziel. Sollte sich die Bundesrepublik hier als Vorreiter erweisen, ist zu hoffen, dass andere EU-Staaten dem deutschen Beispiel auf geeigneterem Wege nachfolgen werden.
Michael Plöse
-
Welt am Sonntag, 20.11.1999 zurück
-
Berliner Zeitung, 15.11.1999 zurück
-
Der Spiegel, 44/1998, S. 126 zurück
-
BVerfGE 49, 89 (142) - Kalkar I zurück
-
BVerfGE 49, 89 (137,141)-Kalkar I zurück
-
§ 17 Abs. 2 AtomG zurück
-
§ 17 Abs. 5 AtomG zurück
-
Neues Deutschland, 4./5. 12. 1999 zurück
-
§ 9 a AtomG zurück
-
Klaus Beer, Ermutigung zum Einstieg in den Ausstieg aus der Atomenergie, in Betrifft JUSTIZ Nr. 56, Dezember 1998, S. 349 zurück
-
BVerfGE 49, 89 (127) - Kalkar I zurück
-
Klaus Beer, Ermutigung zum Einstieg in den Ausstieg aus der Atomenergie, in Betrifft JUSTIZ Nr. 56, Dezember 1998, S. 349 zurück
-
Der Spiegel, 44/1998, S. 124 zurück
-
taz, 25. 1. 1999 zurück
-
Der Spiegel, 25/1999, S. 99 f. zurück